Für den Weg aus der Coronakrise setzen viele auf die Corona-Warn-App. Um Infektionsketten durch das Coronavirus frühzeitig zu erkennen und zu durchbrechen, kann die App einer von vielen Bausteinen sein. Dennoch wird sie vereinzelt kontrovers diskutiert. Ein paar Punkte im Überblick.
Seit dem frühen Morgen des 16. Juni steht in Deutschland die Corona-Warn-App zum Download bereit. Vorgestellt vom Robert-Koch-Institut, von der Politik und SAP- sowie Telekom-Vertretern. Beweisen muss sie sich noch.
Ziele und Chancen
Die App soll als dabei helfen, die Ausbreitung des Coronavirus, die vorwiegend über Tröpfchen und Aerosole geschieht, in Deutschland abzubremsen. Dazu sollen Personen nach Kontakten mit Infizierten gewarnt werden.
Wie geht das? Hat sich ein App-Nutzer mit Sars-CoV-2 infiziert und dies in die App eingegeben, erhalten alle Kontaktpersonen der zurückliegenden 14 Tage, die die Software ebenfalls nutzen, einen Hinweis. Sie können sich so in Quarantäne begeben und testen lassen, selbst wenn sie noch keine Symptome haben. Denn schon bevor sich Symptome bemerkbar machen, besteht eine Infektionsgefahr. In einer Studie (Nature Medicine, 15. April 2020) wurde ermittelt, dass knapp die Hälfte der Ansteckungen vor Beginn der Symptome stattfand.
Mit der Corona-Warn-App soll so unterbunden werden, dass Patienten die Krankheit unbemerkt weitertragen. Im Pandemie-Alltag kommt es immer wieder zu zufälligen Begegnungen, was eine manuelle Nachverfolgung erschwert. Hingegen registriert die App alle nahen Kontakte, sobald sich zwei Smartphones lange genug bis auf unter 2 Meter nahekommen. Damit lasst sich das Gesundheitsamt-Prozedere ergänzen und ist dabei deutlich schneller.
Wie ist die App entstanden und wie funktioniert sie?
Der Softwarekonzern SAP ist für die Programmierung und weitere Optimierung verantwortlich, der Telekommunikationsspezialist Telekom für die Netzwerk- und Mobilfunktechnik. Die App nutzt den Funkstandard Bluetooth Low Energy (BLE), deshalb muss beim Nutzer am Mobilphone immer Bluetooth eingeschaltet sein. Zur Erforschung der Technologie unter Annäherung der Nutzer wurde die Fraunhofer-Gesellschaft mit einbezogen.
Das Prinzip hinter der Software? Alle paar Minuten wird eine neue Identifikationsnummer erstellt und an die nahe Umgebung ausgesendet, gleichzeitig werden die Signale anderer registriert. Sind zwei Smartphones mit der Corona-Warn-App über eine gewisse Zeit weniger als in einem definierten Abstand voneinander entfernt, werden die beiden anonymen Identifikationsnummern auf beiden Smartphones verschlüsselt ausgetauscht. Hat ein Nutzer nachfolgend Krankheitssymptome, kann er das freiwillig über die App eingeben und so die gefährdeten Kontakte warnen. Identität und Standort der betreffenden Personen werden nicht erhoben. Die Bundesregierung hat aus Datenschutzgründen einer dezentralen Speicherung der Daten zugestimmt, also nur auf den Smartphones der Nutzer selbst.
Entwickelt wurde die App in nur 7 Wochen. Der Quellcode ist offengelegt, eingeschlossen werden Faktoren wie Kontaktzeit, Kontaktnähe (unter 2 m) und Übertragungsrisiko (Infektionszeit). Theorie ist eine Sache, wie gut das Warnsystem letztlich in der Praxis funktioniert, ist noch unklar. Erfahrungen werden sicher noch dazugewonnen, auch hinsichtlich Eignung der Bluetooth-Technologie für die Distanzbestimmung.
Wie steht es um die Privatsphäre? Das Konzept sieht vor, dass Teilnehmer anonym bleiben, da bei der Kontaktverfolgung nur anonymisierte und regelmäßig ändernde Schlüssel eigesetzt werden. Informationen über das Zusammentreffen von Personen, die die Corona-Warn-App nutzen, erfolgt dezentral auf deren Smartphones. Dem Server der Betreiber liegt demnach eine Liste mit den anonymisierten Schlüsseln von Infizierten vor.
Welche Kritikpunkte gibt es?
Zusätzlich zur Bluetooth-Technologie an sich gibt es weitere Punkte, die für ein gutes, reales Abbild hinterfragt werden: So wird nicht berücksichtigt, ob die Nutzer Masken tragen oder sich in Räumen, draußen oder in großen Räumlichkeiten mit starken Konvektionen aufhalten.
Damit die App überhaupt einen guten Effekt hat, müssten laut einer Oxford-Studie mindestens 60 % der Bevölkerung diese nutzen (und Bluetooth eingeschaltet haben). Laut vieler Virologen ist aber auch ein geringerer Anteil an Nutzern sinnvoll, um frühzeitig Cluster zu erkennen. Denn großes Ziel ist, ohne eine zweite Welle über den Winter zu kommen und dafür ist es wichtig, größere Übertragungscluster zu verhindern.
Die Bluetooth-Technologie verbraucht Strom, den manche Bürger nicht immer berücksichtigen, sofern sie Bluetooth nicht schon immer gewohnt angeschaltet haben. Möglicherweise muss man dann einplanen, sein Smartphone öfter zu laden, es lassen sich aber auch energiesparende Einstellungen vornehmen (z. B. Abrufen der E-Mails in größeren zeitlichen Abständen, Ausschalten der GPS-Ortung etc.).
Besitzer älterer Smartphones können sich möglicherweise hier nicht einreihen. Mindeststandards sind bei iPhones das aktuelle Betriebssystem iOS 13.5 (es läuft auf Modellen ab dem iPhone 6s und dem iPhone SE), bei Android-Smartphones Betriebssystem-Versionen, die Bluetooth Low Energy (BLE) und Play Store unterstützen. Und Huawei? Da neue Modelle aufgrund US-Sanktionen die Google-Dienste nicht verwenden dürfen, stellt das Unternehmen eine eigene Schnittstelle bereit. Problematisch wird es auch für die ältere Bevölkerung, die entweder gar kein Smartphone benutzt oder die App nicht selbst installieren kann. Gerade diese verstärkt gefährdete Bevölkerungsgruppe wird dann nicht erfasst. Auch wird kritisiert, dass Personen, die sich kein entsprechendes Smartphone leisten können, außen vor gelassen werden.
Die Bundesregierung betont die Freiwilligkeit der App-Nutzung. Die Kontaktverfolgung ist demnach nur dann möglich, wenn man die App selbst installiert und den Datenaustausch im Betriebssystem selbst aktiviert. Um Vertrauen zu stärken, wird ein begleitendes Gesetz diskutiert, das die Freiwilligkeit der Nutzung festschreibt. Denn manche Bürger befürchten, dass etwa Unternehmen ihren Mitarbeitern oder Restaurants ihren Besuchern das Nutzen der Corona-Warn-App zukünftig vorschreiben könnten.
Ein neuralgischer Punkt ist die teilwiese mangelnde digitale Anbindung vieler Labore: Ist man positiv auf COVID-19 getestet, gibt man diesen Status selbst in die App ein. Um einen Missbrauch zu verhindern, muss dieser Status offiziell bestätigt werden. Dazu erhält man vom Test-Labor einen QR-Code zum Einscannen. Der Haken: Viele Labore sind nicht ausreichend sicher digital angebunden. Die Installation neuer Server können sich noch Wochen bis Monate hinziehen. Als Übergangslösung haben das Gesundheitsministerium und das Robert-Koch-Institut eine 24-Stunden-Hotline eingerichtet, deren Mitarbeiter entsprechend geschult sein und zielgerichtete Fragen stellen sollen, um einen Missbrauch der App-Warnfunktion durch Falschinformationen möglichst zu verhindern. Erst dann erhält man einen Code.
Neben dieser Verifikations-Hotline wird es eine weitere Hotline zur Beantwortung technischer Fragen geben. Auch sollen weitere Entwicklungen kommen, die die App weitgehend barrierefrei gestalten und in mehreren Sprachversionen verfügbar machen.
In Europa werden unterschiedliche Apps genutzt, alle zwar immer mit dem Ziel, Infektionsketten zu verfolgen, aber mit unterschiedlichen Systemen. In vielen Ländern wird die Standorterkennung mit GPS genutzt, die jedoch Bewegungsprofile von Personen anfertigt, was den deutschen Datenschutzanforderungen widerspricht. Das langfristige Ziel ist, verschiedene Apps von EU-Staaten untereinander kompatibel zu machen. Aktuell ist das noch nicht der Fall.
Pro Land gibt es immer nur eine offizielle Tracing-App zur Nachverfolgung möglicher infektiösen Kontakte. Es gibt zwar andere Apps, diese haben aber andere Ziele, wie etwa die Datenspende-App des Robert-Koch-Instituts, die Informationen von Fitness-Trackern erhält. Damit soll u. a. eine Fieberkarte für Deutschland berechnet werden, mit der Rückschlüsse auf eine Region gezogen und so z. B. die Entstehung neuer „Hot Spots“ von COVID-19 sichtbar gemacht werden können.



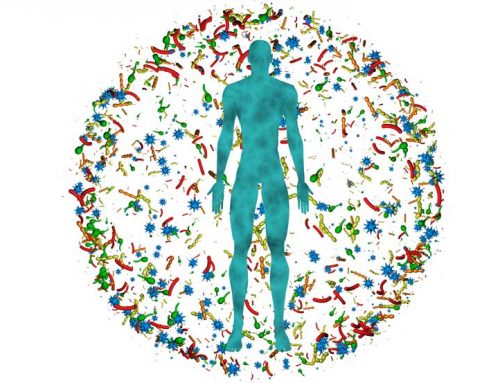


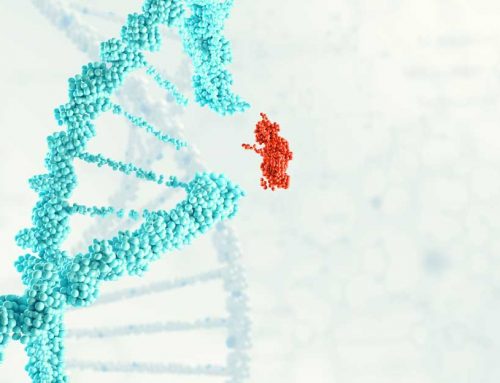
Social Contact